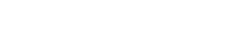Allerheiligen
„Am ersten Novembertag gedenken wir aller Menschen, die bei Gott sind. Das Fest Allerheiligen ist das „Familienfest“ der Kirche. Ein Fest, das in unserer Tradition zusammenfließt mit dem Fest Allerseelen. Im Wort Aller-Heiligen steckt das Wort „Heil“. Heilbringende Menschen sind für sich und andere Licht, leuchtend (deshalb die Kerzen), machen das Leben blumig, farbenfroh (deshalb die Blumen), bringen es zum Duften (deshalb Weihrauch). So hat es seine Bedeutung, dass die Kirche Allerseelen an das Fest Allerheiligen anschließt.“1
Zu Allerheiligen feiern wir alle Heiligen. Da in den ersten Jahrhunderten die Zahl der Heiligen rasch anstieg, gab es bald mehr Heilige als Kalendertage. So wurde überlegt alle Heiligen an einem gemeinsamen Feiertag zu verehren. Im 8. Jahrhundert weihte Papst Gregor III. eine Kapelle im Petersdom allen Heiligen und legte für Rom den Festtag auf den 1. November. Allerheiligen ist ein Hochfest, in den meisten katholischen Diözesen ein gebotener Festtag und wird auch von den orthodoxen (am Sonntag nach Pfingsten), den anglikanischen und den evangelischen Kirchen gefeiert. Die liturgische Farbe dieses Festes ist weiß. In vielen Orten ist es Brauch, dass die Tauf- oder Firmpaten und -patinnen ihren Patenkindern Allerheiligenstriezeln schenken.
„All Hallows“ – so lautet der englische Name von Allerheiligen. Der Vorabend ist „All Hallows‘ Eve“ – uns besser bekannt in der undeutlich ausgesprochenen Bezeichnung „Halloween“.
Allerseelen
Am Nachmittag des Allerheiligentages beginnt mit dem Friedhofsgang das Fest Allerseelen. Die Menschen gedenken der Verstorbenen im Gebet, besuchen die Gräber, die gesegnet werden. In den liturgischen Texten von Allerseelen beten wir für die Verstorbenen. In der Auferstehung Jesu verbinden sich Himmel und Erde. So glauben wir an eine Gemeinschaft aller Glaubenden über den Tod hinaus, über alle Zeiten hinweg. Für die Verstorbenen zu beten ist dabei einerseits eine Hilfe für die Verstorbenen. Gleichzeitig dürfen wir sie auch bitten, auf uns zu schauen und für uns zu beten.
„Das Gedenken der Verstorbenen und die Sorge um ihr „jenseitiges“ Leben gehört zu den ältesten Quellen religiösen Verhaltens der Menschheit überhaupt. Für den christlichen Glauben ist die Hoffnung und die Zusage der Auferstehung tragend, dass unsere Toten in ihrem Sterben in die liebenden und vollendenden Hände Gottes gefallen sind. Mit dem im Spätmittelalter entstandenen Bild vom Fegefeuer als Reinigungsort für die sündigen Seelen hat sich in der katholischen Kirche eine besondere Sorge um das Heil der Verstorbenen entwickelt, für das man betete und Messen bezahlte. Das mit dem 2. Vatikanischen Konzil reformierte Totengedenken stellt dagegen den Glauben an die Auferstehung, an die verzeihende Liebe Gottes und an die heilsame Verbindung der Lebenden mit den Toten in den Vordergrund. Allerseelen ist darum wie Allerheiligen das Fest der ganzen Kirche, die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten, die auf dem Weg zur endgültigen Vollendung sind.“2
Das Allerseelenfest wurde etwa um 1000 nach Christus durch das französische Kloster Cluny eingeführt und von dort verbreitete es sich in Europa. Es wird in der liturgischen Farbe schwarz oder lila gefeiert. In der Messfeier gibt es kein Gloria und beim Ruf vor dem Evangelium wird das Halleluja durch einen Christusruf (z.B. Lob dir, Christus, König und Erlöser) ersetzt.
Seelensonntag
In manchen Regionen wird auch ein „Seelensonntag“ gefeiert, an dem besonders der Opfer von Krieg, Gewalt und Hass gedacht wird, üblicherweise ist das der erste Sonntag nach Allerheiligen.
Feste der Unvergänglichkeit
Da vielerorts Allerseelen kein Feiertag ist, besteht die Gefahr, dass Allerheiligen nur auf das Totengedenken reduziert wird. Andererseits gibt dies auch die Chance, die Kirche in österlicher Hoffnung als zur Auferstehung berufene Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen zu sehen. In der kalten Jahreszeit drücken beide Feste den Glauben an die Unvergänglichkeit der Heiligenwelt im Kontrast zur Vergänglichkeit der Natur aus.
aus KinderGottesdienstGemeinde Nr. 125